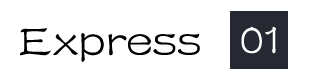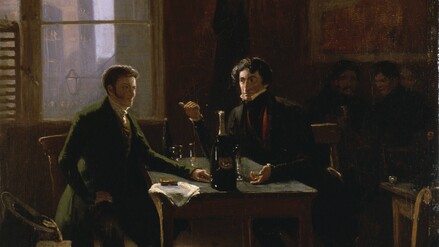Die Welt braucht eine Wissenschaft, die sich nicht nur in der rechtsstaatlichen Demokratie frei entfaltet, sondern sich wenigstens einen Tag der Woche aktiv für unsere Demokratie einbringt und mit der Gesellschaft gemeinsam wissensbasiert Lösungen schafft. In der Mitte Berlins sind alle Voraussetzungen gegeben, dass diese längst überfällige Evolution gelingen kann.
Vor über 200 Jahren kreierte Wilhelm von Humboldt in Berlin die moderne Universität: Lehre und Forschung wurden zusammengeführt. Als Infrastruktur bekam dieser neue Universitätstyp, heute die Humboldt Universität zu Berlin, Sammlungen als Morgengabe. Die Grundlagen einer beispiellosen Erfolgsgeschichte „Made in Berlin“ waren gelegt. Bis heute bildet diese Art der Universität weltweit Eliten aus. Doch reicht das angesichts der Herausforderungen?
„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind“, wusste schon Albert Einstein. Die notwendige tiefe Veränderung muss vielmehr als Chance ergriffen werden. Ein oft beschworenes Weiter-so führt zum langsamen Tod, erstickt Wissenschaft und eine lebendige Demokratie.

Johannes Vogel ist Generaldirektor des Museums für Naturkunde. Außerdem ist er Professor für Biodiversität und Wissenschaftsdialog an der Humboldt Universität.
Wir wissen, dass sich die Wissenschaft, dass wir uns selbst wandeln müssen. Wir müssen uns als eine für alle Menschen relevante, in und mit der Gesellschaft forschende, zuhörend-reflektive und weiterhin exzellente Wissenschaft in Berlin neu erfinden.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.
Einen Tag in der Woche für unsere rechtsstaatliche Demokratie
Und wie sieht das aus? Der Prozess von Wissenschaft und das Verstehen von Wissenschaft als Prozess steht im Mittelpunkt des neuen Miteinander von Gesellschaft und Wissenschaft. Nicht mehr das Verkünden neuer Erkenntnisse als frohe Botschaften (Wissenschaftskommunikation), sondern Einbindung, Mitmachen, Zuhören, gemeinsam wissensbasiert Lösungen finden (Public Engagement) steht im Vordergrund.
Wie exzellente Forschung sind 2030 auch „Up-stream public engagement“, Ko-Kreation, Ko-Produktion oder Bürgerwissenschaften als „ernsthaftes“ wissenschaftliches Arbeiten anerkannt. Ungefähr 20 Prozent der Arbeitskraft und 20 Prozent aller Ressourcen – wohlgemerkt eines Instituts (und des gesamten Wissenschaftssystems) nicht von jedem Forschenden – werden dafür eingesetzt. Wer will, kann sich – ohne Schaden für die eigene Karriere! – für Partizipation oder Politikberatung engagieren.
Gemeinsam mit diversen Akteuren aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik wird an wenigstens einem Tag der Woche am tiefen und respektvollen Austausch gearbeitet, was viel Spaß bereitet. Zuhörend und vereint entwickeln sie konkrete Wege für eine gute und solidarische Zukunft unseres Landes und sie formulieren auch neue Fragen an die Wissenschaft, auf die diese oftmals gar nicht gekommen wäre.
Die gemeinsame Arbeit fördert nicht nur die Wissenschaft und die Zusammenarbeit quer durch die Gesellschaft. Die gemeinsamen Projekte stärken auch soziale Bindungen vor Ort. Sie schaffen Vertrauen, machen Wissenschaft „erlebbar“ und relevant, sie fördert das Selbstvertrauen jedes Menschen, sich seines gesunden Menschenverstandes im Gespräch mit anderen zu bedienen – und neugierig auf andere Sichtweisen zu bleiben.
Serie „Berlin 2030“
In unserer Serie „Berlin 2030“ wollen wir konstruktive Lösungen für die Herausforderungen der Hauptstadt finden und dabei helfen, positiv in die Zukunft zu schauen. Dafür sprechen wir mit Vordenkerinnen und Visionären, mit Wirtschaftsvertretern, mit Kulturschaffenden, mit Stadtplanern, mit Wissenschaftlerinnen und Politikern.
In Gastbeiträgen fragen wir sie nach ihrer Vision für Berlin. Wie soll Berlin im Jahr 2030 aussehen? Welche Ideen haben sie für die Zukunft unserer Stadt? Und welche Weichen müssen dafür jetzt gestellt werden?
Die Beiträge der Serie stammen unter anderem von Kai Wegner, Renate Künast, Ulrike Demmer, Tim Raue, Mo Asumang und Christian Schertz. Alle bisher erschienen Beiträge finden Sie hier.
Sie haben auch eine Idee? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an: checkpoint@tagesspiegel.de.
Selbstverständlich für mich ist hier der mit Abstand größte globale Wohlstands- und Wirtschaftsfaktor, die Natur. Eine funktionierende Natur versorgt uns mit Luft, sauberem Trinkwasser, gesunden Böden für gesunde Nahrung, Kleidung und Medikamenten.
Die derzeitige zerstörerische Wirtschaftsweise gefährdet diese lebenswichtigen Notwendigkeiten aller Menschen. Deshalb heißt Eintreten für Natur auch, konsequent Menschen zusammenzubringen, Gemeinschaften zu fördern und gemeinsam ein gesundes, gutes, gerechtes Leben zu gestalten.
Mit dem Zukunftsplan ist das Museum für Naturkunde Innovationsmotor und Experimentierfeld
Die natürlichen Grundlagen unseres Lebens auf diesem Planeten zu erhalten, ist etwas zutiefst Konservatives. Dafür müssen wir hier und heute loslegen. Was dafür oft fehlt, ist nicht unbedingt der politische Wille, es sind die politischen Mehrheiten. Daran wollen wir, das Berliner Naturkundemuseum als sammlungsbasiertes Forschungsmuseum, mitwirken. Dafür verändern wir uns als Wissenschaftsorganisation und lassen die Gesellschaft an unserer Evolution teilhaben, ja mitwirken.
Schon heute ist das Naturkundemuseum immer wieder Experimentfeld für eine Zukunft, die nach demokratischen Spielregeln gestaltet wird. Das Museum an der Invalidenstraße liegt inmitten eines großen Kraftraums aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik.

© Thomas Rosenthal
Zieht man einen Kreis mit einem Durchmesser von zwei Kilometern um das Museum, so sind die großen Themen der Gegenwart und der Zukunft wie zum Beispiel Gesundheit, Sicherheit, Ernährung, Mobilität, Wirtschaft, Energie, Klima, Natur, soziale globale Gerechtigkeit stark vertreten.
Dafür stehen Organisationen wie der Bundesnachrichtendienst, Bayer, die Leibniz-Gemeinschaft (zu der das Museum gehört), Misereor, Brot für die Welt, Amnesty International, das Gesundheitsministerium, der renommierte Life Science Campus der Humboldt-Universität, die Charité, das weltweit anerkannte und zudem größte Forschungskrankenhaus Europas, namhafte Institute der Helmholtz- und Max-Planck-Gesellschaft, das Bildungs- und Forschungsministerium, der Bundestag, das Kanzleramt, der Hauptbahnhof, das Futurium, der Hamburger Bahnhof, SAP, das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz oder das Ministerium für Digitales und Verkehr.
Wir haben hier in Mitte eine riesige Konzentration an Macht, Perspektiven und Wissen. Hier muss ein Kraftraum für unsere Demokratie entstehen.
Vielleicht vergleichbar zu der Mall in Washington, wo auf der einen Seite die Ministerien sind und auf der anderen die Museen. In Washington sind diese Gebäude ursprünglich bewusst so platziert worden, dass Kultur und Macht sich spiegeln.
In Berlin hat sich diese Nachbarschaft eher zufällig ergeben. Doch der wichtigste Unterschied zu Washington ist: In Berlin-Mitte gibt es bereits eine respektvolle Interaktion zwischen der Politik, Kultur und der Wissenschaft. Das ist die Chance, einen attraktiven Zukunftsort mit internationaler Strahlkraft zu gestalten – für unsere Demokratie und die unsere Zivilisation tragende Natur.
Das Naturkundemuseum wird dafür handeln. Mithilfe des vom Bundestag und Abgeordnetenhaus finanzierten Zukunftsplans bauen wir jetzt das ganze Museum, das ja auch schon in die Jahre gekommen ist, konzeptionell und baulich um.
In der großen Eingangshalle, in der sich gegenwärtig noch die Dinosaurier befinden, wird Raum für ein „Parlament der Natur“ geschaffen. Hier wollen wir gemeinsam mit vielfältigsten Akteuren auf die Reise für eine gute Zukunft gehen, wollen Zukunft gemeinsam erarbeiten und gestalten, wollen die Zusammenarbeit mit den Menschen unabhängig von Herkunft fördern und die Faszination von Wissenschaft für alle erlebbar und auch mit gestaltbar machen.
Wir werden wissensbasiert zu einem starken Rückgrat einer modernen, freiheitlichen Gesellschaft und Berlin-Mitte zu einem Impulsgeber für eine demokratisch wirkende Wissenschaft entwickeln. Machen wir uns vereint ans Werk!