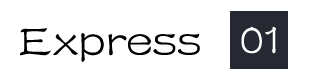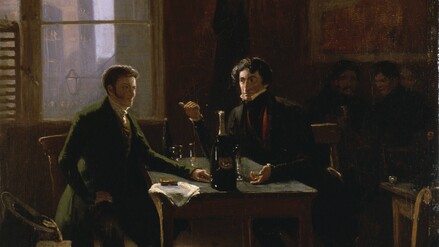Frau Kanitz, Sie sagen, der 7. Oktober habe weltweit eine antisemitische Eskalationsspirale in Gang gesetzt. Wie schlimm ist die Situation?
Das Ausmaß und die Regelmäßigkeit dieser Eskalationsspirale sind schockierend. Im gesamten Kulturbetrieb setzte, unmittelbar nach dem 7. Oktober, ein starker Positionierungsdruck ein, der inzwischen bizarre Ausmaße erreicht hat. Wir beobachten einerseits die fortschreitende Dämonisierung israelischer beziehungsweise jüdischer Künstler. Die Hetze gegen sie ist noch deutlich schlimmer als in den Jahren vor dem Massaker.
Andererseits werden auch nichtjüdische Künstler attackiert, die keine Lust auf unterkomplexes Israel-Bashing haben und es wagen, öffentlich gegen Antisemitismus Stellung zu beziehen. Man versucht, sie an Ihrer Berufsausübung zu hindern und zum Schweigen zu bringen.
Vor dem 7. Oktober übte bereits die anti-israelische Bewegung BDS, abgekürzt für Boycott, Divestment and Sanctions, massiven Druck aus.
Genau, aber sieht man sich die Entwicklungen seit dem 7. Oktober an, wird deutlich, dass es den BDS im Grunde gar nicht mehr braucht. Die Boykottaufrufe, Drohungen und antisemitischen Ressentiments kommen heute aus ganz unterschiedlichen Milieus. Was BDS vor zwei Jahrzehnten begonnen hat, trägt sich seit dem 7. Oktober quasi von allein weiter.
Wie oft sind diese Attacken erfolgreich?
Sehr häufig, aber zum Glück nicht durchgehend. Einer, der immer wieder durch seine Standhaftigkeit auffällt, ist zum Beispiel der Sänger Nick Cave. Seit Jahren wird er bedrängt, Konzerte in Israel abzusagen. Davon lässt er sich aber nicht einschüchtern. In Deutschland sind es Künstler wie die Sängerin Balbina, die dem zunehmenden Antisemitismus etwas entgegensetzen und öffentlich Stellung beziehen. Die Initiative „Artists Against Antisemitism“ wurde schon in Deutschland gegründet und hat nach dem 7. Oktober noch einmal Zulauf erhalten.
Zur Person

© privat
Maria Kanitz ist Politikwissenschaftlerin. Gemeinsam mit dem Soziologen Lukas Geck hat sie soeben das Buch „Lauter Hass: Antisemitismus als popkulturelles Ereignis“ (Verbrecher-Verlag) veröffentlicht. Vor drei Jahren erschien von ihnen bereits „Klaviatur des Hasses“.
Der Hauptfokus Ihres neuen Buches liegt nicht auf den angegriffenen Künstlern, sondern denen, die selbst Antisemitismus verbreiten…
Dieses Phänomen konnte man diesen Sommer ja mehrfach auf Musikfestivals beobachten. Manche Konzerte werden immer mehr zu Protestkundgebungen. Viele Künstler geben sich insbesondere seit dem 7. Oktober als Sprachrohr für Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten aus. Bei einigen wird man leider den Eindruck nicht los, es gehe ihnen nicht darum, auf das Leid im Gazastreifen aufmerksam zu machen, sondern um performativen Widerstand.
Was meinen Sie damit?
Dort findet eine Aneignung des Leids statt, um sich auf der richtigen Seite der Geschichte zu wähnen und damit obendrein Geld zu verdienen. Es geht um die Pose. Auffällig ist dabei das Credo „Palestine will set us free“. Da wird die Palästinafrage zur Menschheitsfrage erhoben. Der dahinterstehende Gedanke richtet sich indirekt nicht nur gegen Israel, sondern gegen Juden weltweit. Mit Frieden, Menschenrechten oder Humanismus hat das wenig zu tun.
Wie bewerten Sie die kursierenden offenen Briefe?
Ich verstehe nicht, warum Prominente es nicht schaffen, in ihren offenen Briefen auf das Leid in Gaza aufmerksam zu machen und gleichzeitig anzuerkennen, dass es auch in Israel eine leidende Zivilbevölkerung gibt. Viele Unterzeichner haben es bis heute nicht geschafft, einmal zu benennen, was eigentlich am 7. Oktober 2023 passiert ist: dass an diesem Tag Menschen vor den Augen der Weltöffentlichkeit massakriert, Frauen vergewaltigt und Geiseln verschleppt wurden.
Wenn über die Ereignisse des 7. Oktober konsequent geschwiegen wird, entsteht schon der Eindruck: Der Humanismus, für den sich viele Künstler einsetzen, ist ein ausgesprochen selektiver.
Sie haben unterschiedlichste Merkwürdigkeiten dieser Szene herausgearbeitet.
Auffällig ist etwa, dass die meisten Künstler, die ihre Solidarität mit Palästina performativ demonstrieren, niemals Kritik an den umliegenden arabischen Staaten äußern. Dass Ägypten, zum Beispiel, nach Kriegsbeginn die Grenzen geschlossen und Palästinensern so die Flucht unmöglich gemacht hat, erfährt man weder von Roger Waters noch von Björk oder Patti Smith. Auch nicht, dass palästinensische Geflüchtete in Jordanien seit jeher in Flüchtlingscamps leben und zu großen Teilen keine Arbeitserlaubnis haben. Dies wird alles ausgeblendet.
Viele Unterzeichner haben es bis heute nicht geschafft, einmal zu benennen, was eigentlich am 7. Oktober 2023 passiert ist.
Maria Kanitz
Im Buch benennen Sie auch viele Beispiele für klaren Antisemitismus. Welche haben Sie besonders entsetzt?
Das waren diverse Äußerungen von Roger Waters auf seinen Social-Media-Kanälen. Es gab auch ein paar Künstler, bei denen ich beim Recherchieren dachte „Bitte nicht jetzt auch noch die!“ und bei denen ich dann persönlich getroffen war, als wir dennoch fündig wurden. Massive Attack zum Beispiel, die habe ich sehr gern gehört. Auch Macklemore übrigens (Bild oben vom Konzert im Berliner Olympiastadion, Anm.d.R.). Ein Kapitel unseres Buches haben wir daher auch „Kill your darlings“ genannt.
Sie schreiben, der Antisemitismus lasse sich leicht in der Musik transportieren. Inwiefern?
Musik ruft Emotionen hervor, Musik ist oft auch identitätsstiftend. Man entwickelt persönliche Verbindungen zu bestimmten Songs, Alben oder Künstlern. All dies macht Musik zu einem gerade idealen Träger, um Antisemitismus niedrigschwellig zu verbreiten. Bei Antisemitismus geht es auch darum: Man fühlt, dass auf der Welt Ungerechtigkeiten stattfinden, und macht dafür eine bestimmte Gruppe, in diesem Fall halt Juden, verantwortlich.
Welche Kritik an Israel ist legitim?
Jeder Mensch, der nicht völlig verroht ist, kann und muss auf die Lage im Gazastreifen aufmerksam machen. Also auf das Ausmaß der Zerstörung, auf die Zehntausenden Toten und auch auf den Hunger. Genauso gehört die Regierung Israels unter Benjamin Netanjahu kritisiert, etwa für ihre Kriegsführung oder den Siedlungsbau im Westjordanland. Aber dies geht eben auch ohne antisemitische Codes und Narrative. Das schaffen zum Beispiel jede Woche hunderttausende Israelis, die gegen den Krieg demonstrieren. Es ist echt nicht so schwer.
Hören Sie nach der Recherche noch Massive Attack, Frau Kanitz?
Aktuell nicht mehr. Wir haben das Buch aber selbstverständlich nicht geschrieben, um zu sagen: Leute, hört auf, diesen oder jenen Künstler zu hören. Viele ältere Fans von Roger Waters verbinden zum Beispiel ihr eigenes Erwachsenwerden mit Pink Floyd. Warum sollte man denen verbieten wollen, Waters zu hören? Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen sollte.