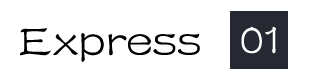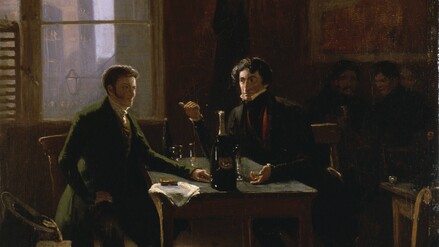Das EM-Halbfinale gegen Spanien haben die deutschen Fußballerinnen verloren. Ein anderer Kampf aber beginnt nun erst. Und der darf nicht verloren gehen. Es geht um die besondere Kultur, die Fans und Spielerinnen über die Jahre geschafft haben.
Mehr als 14 Millionen Menschen sahen die Fernsehübertragung des Halbfinals gegen Spanien in der ARD, das ist ein deutliches Signal für den Fußball der Frauen, der längst kein Nischenprodukt mehr ist, sondern die breite Masse erreicht hat. Die Fußballerinnen erhalten endlich die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die sie sich über Jahrzehnte hart erarbeiten mussten.
Das hat nicht zuletzt mit den sportlichen Erfolgen zu tun: erst die Finalteilnahme in England 2022, dann Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris und jetzt der überraschende Sieg in Unterzahl gegen Frankreich. Mit herausragenden Leistungen steigen im Sport häufig auch die öffentliche Aufmerksamkeit und die Einschaltquoten.

Inga Hofmann war beim Halbfinale in Zürich dabei und berichtet regelmäßig über den Fußball der Frauen. Sie findet: Der Männerfußball darf nicht der Maßstab sein.
Das wachsende Interesse hat aber noch einen anderen, weitaus entscheidenderen Grund: Der Fußball der Frauen liefert dem Publikum Aspekte, die bei den Männern längst abhandengekommen sind. Viele Fans haben keine Lust auf Großturniere in Katar oder Saudi-Arabien und sind müde von dem Gigantismus der Männer, der sich in astronomischen Transfersummen und Gehältern widerspiegelt.

© AFP/SEBASTIEN BOZON
Sie schätzen den Fußball der Frauen für die Nahbarkeit der Spielerinnen und können sich besser mit ihnen identifizieren. „Es wird Jungs geben, die sagen: ‚Ich will jetzt halten wie Ann-Katrin Berger’“, sagte DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch.
Auch in den Stadien waren zahlreiche Männer zu sehen, die Trikots von Klara Bühl und Jule Brand trugen, das war vor ein paar Jahren noch schwer vorstellbar.
Die Aufmerksamkeit hat auch ihre Schattenseite
Rein sportlich gesehen wächst die Anerkennung für die Leistung der Spielerinnen ebenfalls. Mussten sie sich vor einigen Jahren noch häufig anhören, dass das doch „gar kein richtiger Fußball“ sei, zeigen sich viele Menschen nun in den sozialen Medien, auf den Fanmeilen und in den Fußballkneipen beeindruckt von der körperlichen Leistung, die etwa Torhüterin Berger an den Tag legte.
Unter dem Kommerzialisierungsdruck gestaltet es sich immer schwieriger, die Werte zu wahren, für die der Fußball der Frauen steht.
Inga Hofmann, Sportredakteurin
Doch bei aller Euphorie darf nicht aus dem Blick geraten, dass die wachsende Aufmerksamkeit auch ihre Schattenseite hat: Die Spielerinnen stehen vermehrt im Fokus und müssen daher besser geschützt werden. Jessica Carter, englische Nationalspielerin, etwa war bei der EM massiven rassistischen Anfeindungen ausgesetzt, doch der Verband wirkt überfordert mit dem Thema, erhielt kaum Unterstützung von der UEFA.
Hinzu kommt die wachsende Kommerzialisierung. Natürlich sollte jede Spielerin von ihrem Sport leben können und nicht nebenher studieren oder arbeiten müssen, wie es leider in der Bundesliga immer noch der Fall ist.
Doch auf internationaler Ebene werden mittlerweile Summen diskutiert, die damit wenig zu tun haben: Für 1,15 Millionen Euro wechselte die englische Spielerin Olivia Smith kürzlich von Liverpool zu Arsenal.
Die Stadionkultur droht verloren zu gehen
Das wird auch von einigen deutschen Nationalspielerinnen kritisch gesehen, wie Giovanna Hoffmann, die dafür plädierte, lieber alle Spielerinnen in der Breite gut zu versorgen, anstatt für einzelne Millionen auszugeben.
Damit hat sie recht, gerade in der Breite müssen Mädchen besser gefördert und Nachwuchsleistungszentren ausgebaut werden, um langfristig auch die Spitze zu stärken. Außerdem: Was macht es mit der Mentalität der Spielerinnen, wenn sie plötzlich derart hofiert werden?
Auch die offene, tolerante Stadionkultur droht unter den aktuellen Entwicklungen verloren zu gehen. Immer häufiger hört man inzwischen bei den Spielen der Frauen von Pöbeleien, wie etwa beim Halbfinale gegen Spanien, was man zuvor eigentlich nur von den Männerspielen kannte.
Diese Entwicklung wird auch von deutschen Vereinen besorgt zur Kenntnis genommen, etwa von den Frauenteams bei Hertha BSC oder dem 1. FC Union Berlin, und auch Nationalspielerin Laura Freigang plädierte dafür, die Stadionkultur gezielt zu schützen.
Nach der EM, die am Sonntag mit dem Finale England gegen Spanien endet, müssen Fans, Verbände und Vereine sich mehr denn je die grundlegende Frage stellen, wie sie den Fußball der Frauen zwar voranbringen, aber gleichzeitig die Aspekte schützen können, die ihn auszeichnen. Unter dem Kommerzialisierungsdruck gestaltet es sich immer schwieriger, die integrative Wirkung und die Werte zu wahren, für die der Fußball der Frauen steht.
Gelingt dieser Drahtseilakt nicht, droht dieser „sichere Raum“, wie er von vielen Spielerinnen und Fans bezeichnet wird, verloren zu gehen. Und mit ihm die besondere Kultur, die Spielerinnen und Fans über Jahre geschaffen haben und die jetzt bei dieser EM so eindrucksvoll zu erleben war.